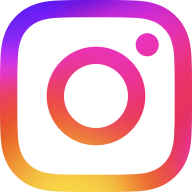Ungleich, un(ter)bezahlt, unsichtbar
Ein Workshop für Erwachsenenbildnerinnen/Erwachsenenbildner
Eine Veranstaltung des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung (bifeb) und der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB)
Gesellschaftliche Ungleichheiten sind zugleich Gegenstand der Erwachsenenbildung, als auch Auftrag an die Erwachsenenbildung: Denn die Erwachsenenbildung kann einerseits dazu beitragen, strukturelle Benachteiligungen zu analysieren, und damit andererseits die Urteils- und Handlungsfähigkeit der Lernenden fördern.
Eine zentrale Achse von Ungleichheit umfasst die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. In Österreich steigt die Zahl der erwerbstätigen Frauen seit Mitte der 1970er-Jahren kontinuierlich an, jedoch arbeiten sie heute vorrangig in Teilzeit. Die weibliche Vereinbarkeit von Vollzeitjob und Haus- und Sorgearbeit scheint also eher Mythos, denn Realität – oder sie hat einen hohen Preis: In westlichen Industriegesellschaften übernehmen häufig unterbezahlte Migrantinnen die anfallende Care-Arbeit. In diese komplexe Gemengelage mischen sich seit einiger Zeit antifeministische Akteurinnen und Akteure wie „Tradwives“, die auf Social Media reaktionäre Geschlechter- und Familienbilder propagieren.
Im Workshop sollen feministische Perspektiven auf Arbeit gemeinsam mit den Teilnehmenden beleuchtet werden. Dabei wird ein Methodenmix angewandt, der das erworbene Wissen erlebbar und für die eigene Zielgruppe adaptierbar macht.
Inhalte
Der Workshop setzt sich mit feministischen Perspektiven auf Arbeit auseinander und fördert die Auseinandersetzung mit aktuellen Debatten sowie die Selbstreflexion der Teilnehmenden.
Konkret behandelt der Workshop folgende Fragestellungen:
- Wie hat sich die Frauenbewegung historisch mit Arbeit auseinandergesetzt und welche Debatten werden heute geführt?
- Welche Probleme und Lösungsansätze im Bereich der Care-Arbeit gibt es?
- Welche Verbindungen zwischen eigenen Erfahrungen und gesellschaftlichen Strukturen lassen sich finden?
Methodik
Die Workshopleiterinnen greifen auf einen Methodenmix zurück. Interaktive Methoden wie Rollenspiele, soziometrische Aufstellungen, Fishbowl, Biografiearbeit und Medienanalyse kommen ebenso zum Einsatz wie Inputs und Diskussionen.
Dabei steht auch der Praxistransfer im Vordergrund. Denn die Methoden sind dafür geeignet, dass Teilnehmende sie in ihrer eigenen Vermittlungsarbeit verwenden können.
Lernergebnisse
Die Teilnehmenden setzen sich mit einer zentralen Achse von gesellschaftlicher Ungleichheit auseinander und erweitern dadurch ihre Urteils- und Handlungsfähigkeit. Die Beschäftigung mit feministischen Perspektiven auf Arbeit erfolgt anhand von Methoden, die Wissensvermittlung, Austausch in der Gruppe, Selbstreflexion und Praxistransfer zum Ziel haben.
Zielgruppe
Der Workshop richtet sich an Erwachsenenbildnerinnen/Erwachsenenbildner, Bildungs- und Berufsberaterinnen/, Bildungs- und Berufsberater, Trainerinnen/Trainer und Bildungsmanagerinnen/Bildungsmanager.
Der Workshop ist mit 1,0 ECTS im Rahmen der wba akkreditiert.